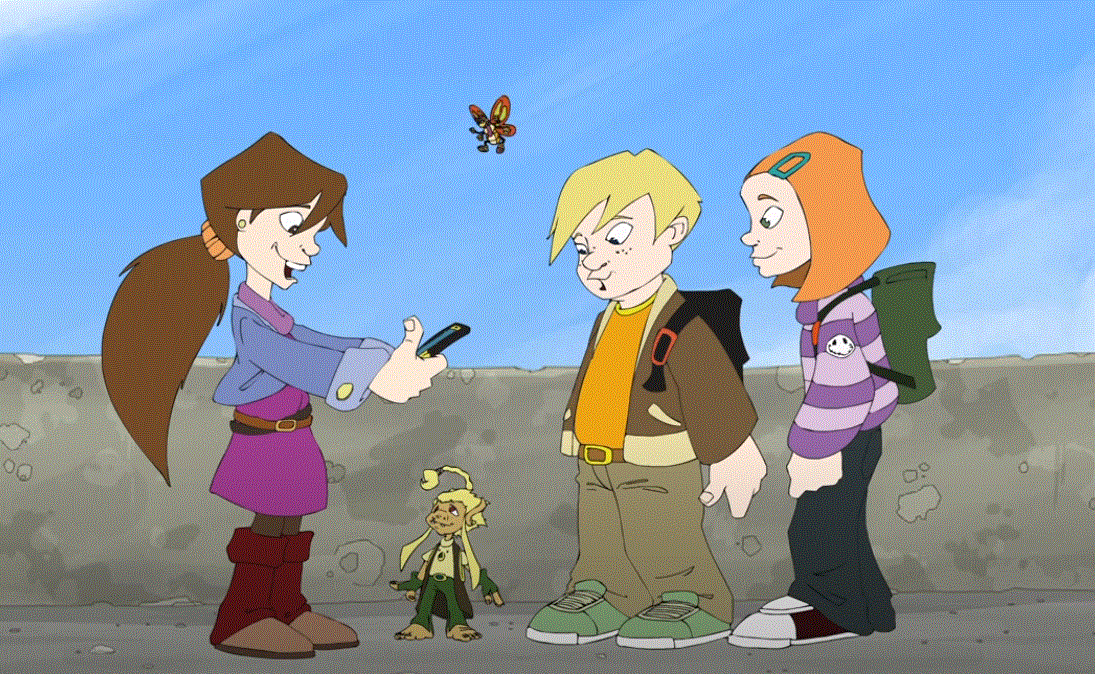Die „Da-Vinci-Formel“
Ich habe mit Leonardo da Vinci zwei Dinge gemeinsam: Ich bin genau 450 Jahre nach seinem Tod geboren und ich bin als Halbwüchsiger auf ein selbstgebasteltes Fluggerät gestiegen, mit dem mich mein Bruder von einem Turm stürzen wollte; aus reinem Erkenntnisinteresse versteht sich ;-). Aber es gibt noch eine Verbindung, die weniger konstruiert ist … Vor ein paar Jahren bin ich mit Jens Möller in einen Austausch über innovatives Denken und Analogien gekommen. Jens ist Innovationscoach und Autor des Buches „Die Da-Vinci-Formel“, zu dem ich jetzt eine kleine Rezension verfasst habe. Viel Spaß beim Lesen!
Rezension
Jens Möller unternimmt in seinem Buch „Die Da-Vinci-Formel“ den Versuch, aus dem Leben und Wirken des Renaissance-Genies Leonardo da Vici (1452-1519) sieben Erfolgsprinzipien herauszuarbeiten und für die Wissensarbeit heutiger Tage fruchtbar zu machen.
In der Einführung schildert Möller seine Motivation zum Schreiben des Buches und liefert eine kurzweilige Skizze zu den wesentlichen Lebensstationen von da Vinci. So erfährt man z.B., dass Leonardo ein uneheliches Kind war, was ihm den Zugang zur Universität verwehrte. Ausgestattet mit einem Übermaß an Wissbegierde suchte Leonardo zeitlebens nach Orten, Menschen und Gegenständen, bei denen er etwas Neues entdecken oder, wie Möller feststellt, geistig „stehlen“ konnte. Treibende Kraft von Genies, so Möller, seien nicht nur oder vor allem eine einzigartige und für Normalmenschen unerreichbare Kreativität, sondern ebenso menschliche und alltägliche Marotten, Spleens oder Ticks.
Um Letzteres geht es im Hauptkapitel des Buches: um hilfreiche Strategien – abgeschaut vom großen Meister –, die unser Denken, Fühlen und Handeln beflügeln, im wahrsten Sinne des Wortes in die Lüfte heben sollen. Zu diesen Strategien zählen laut Möller: (1) Umgib dich mit inspirierenden Menschen. (2) Klaue gute Ideen und perfektioniere sie. (3) Denke mit Stift in der Hand. (4) Verbinde das Unverbundene. (5) Fühle, was andere fühlen. (6) Probe deinen Mut! (7) Folge deinem Stern!
Jedes dieser Prinzipien wird im Buch durch da-Vinci-Zitate und -Leistungen fundiert und teils mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gestützt. So ist es uns zwar intuitiv einsichtig, dass „Notizenmachen“ eine sinnvolle Methode zum Festhalten von Ideen ist, aber zu einer nachhaltigen Kreativmethode, zu einem Erfolgsprinzip der Da-Vinci-Formel, wird es deshalb, weil wir damit feinmotorische, emotionale, visuelle und begriffliche Aktivitäten synergetisch verschmelzen, was zu einer Art mentalen „Sprungbrett“ führt.
Man könnte an dieser Stelle sagen: „Problem erkannt, Gefahr gebannt.“ Möller geht aber noch einen Schritt weiter. Mit dem „Coaching Kompass“ bietet er dem Leser und der Leserin nach jedem Erfolgsprinzip die Möglichkeit, die eigene Kompetenz grob einzuschätzen und mit praktischen Tipps auszubauen. Wie das geht? Z.B. mit dem Tipp, sich die aktuelle Bravo-Zeitschrift zu Gemüte zu führen, um sich produktiv von der Jugendsprache irritieren zu lassen. Oder mit dem Hinweis, in der Fußgängerzone jemanden in ein Gespräch zu verwickeln, um auch kleine Mutproben zu erfahren.
Wie immer geht es beim Thema Kreativität und innovatives Denken um Perspektivenarbeit. Jens Möller gelingt es, den über 500 Jahre alten Großmeister der Perspektivenarbeit – Leonardo da Vinci – nahbar und in seiner Eigensinnigkeit erlebbar zu machen, was eine Leistung ist. Man erhält so nicht nur historische Einsichten; Leonardo gewinnt auch eine menschliche Seite, die zum Vorbild für die eigene Wissensarbeit taugt.
Wer das Buch mit großer Kritikwilligkeit liest, wird sich vermutlich daran stoßen, dass biografische Analyse und Konstruktion relativ flott mit Erfolgsprinzipien verknüpft werden, die sich – folgt man den Einband – zu 7 ErfolgsGESETZEN für innovatives Denken versteigen. Ob all diese „Gesetze“ für innovatives Denken und Handeln gleichranging und universell sind, darf wohl in der Tat bezweifelt werden. Wer das Buch aber neugierig liest und die Empfehlungen als Impulse nutzt, könnte ins Nachdenken kommen und auf diesem Wege sicher die eine oder andere originelle Heuristik mitnehmen.
Außerdem dürften Leserinnen und Leser je eigene interessante Anker in diesem kurzweiligen Buch finden – einen eigenen Anker möchte ich abschließend ergänzen: Will man die „Da-Vinci-Formel“ für die digitale Zukunft nutzbar machen, wäre es interessant, Leonardo noch einmal unter dem Prinzip des „Wahrnehmens, Sehens und Kommentierens“ zu analysieren. Die mehrere tausend Seiten umfassende Sammlung seiner „Notizzettel“ zeigt uns im Kern, wie sich flüchtige Ideen visuell und begrifflich durch Kommentare fixieren lassen. Durch bild- und videobasierte Online-Technologien mit kollaborativer Annotationsfunktion entstehen hier neue mächtige Werkzeuge und „Online-Werkstätten“, die unser aller Denken im Sinne Leonardos „beflügeln“ können.
Kindliche Zwickmühlen
Neulich fuhr ich mit meinem Einkaufswagen durch den Supermarkt, mit Maske, wie sich das in Corona-Zeiten gehört. Plötzlich fiel vor meinen Wagen ein Kinderspielzeug auf den Boden … ein Kindergesicht lachte mich aus einem Buggy an.
Ich spürte schlagartig zwei Impulse in mir: Der erste galt dem Kind und dem runtergefallenen Kinderspielzeug, was man ja als gut erzogener Mann direkt aufhebt, um es den Kleinen wieder in die Hände zu drücken. Der zweite Impuls galt der Mutter, die ihr Kind vor potenziellen Coronaviren fernhalten will und daher vermutlich böse wäre, wenn ich die Quietschente direkt in die Kinderhände zurückgebe.
Diese widersprüchlichen und in etwa zeitgleichen Impulse fühlten sich in Summe schlecht an: für mein emotionales Kleinhirn wie für mein reflexives Großhirn. Nach etwa 1,25 Sekunden rollte ich schweigend und ohne Handlung am Kinderwagen vorbei, ich ließ das Kinderspielzeug links liegen, die Mutter hob es auf.
Alles nicht schlimm, oder?
Ich erzähle das hier nicht, um es öffentlich zu verarbeiten ?. Nein, ich erzähle es, weil es mich an eine Geschichte erinnert hat, die mir ein Freund vor ein paar Wochen erzählte.
Dieser Kollege brachte seine Tochter zum Kindergarten, nachdem dieser sieben Wochen geschlossen war – eine Ewigkeit aus Kindersicht. Die kleine Tochter freute sich also riesig, ihre Freundin wieder zu sehen. Etwa zeitgleich wurde die Freundin von ihrer Mutter zum Kindergarten gebracht. Die beiden sahen sich. Die Tochter meines Freundes lief freudestrahlend und mit ausgestreckten Armen auf ihre Freundin zu. Diese bleib stehen, wie versteinert, versteckte sich schließlich hinter ihrer Mutter.
Was war geschehen? Die Mutter (inklusive ihres Mannes) hält es für besser, wenn sich die Freundinnen bis auf weiteres nicht mehr umarmen, der Corona-Virus lässt das nicht zu. Nun will ich gar nicht über das Für und Wider streiten. Fakt ist, dass beide Freudinnen bitter weinten, die eine weil sie überhaupt nicht verstand, warum sich ihre beste Freundin so verweigerte, die andere, weil sie gefangen war zwischen der Vorgabe ihre Eltern „ja nicht ihre Freundin zu umarmen“ und ihrer inneren Stimme, ihre Freundin nach der langen Zeit „so sehr umarmen zu wollen“.
Mich interessiert an diesem Bild genau die letzte Szene: diese emotionale Zwickmühle, dieser doppelte und widersprüchliche Impuls, der vielleicht eine schwache Ähnlichkeit mit meinen Impulsen oben hat. Nur mit einem wichtigen und entscheidenden Unterschied!
Während ich – ein Erwachsener – mir solche emotional-kognitiven Zwickmühlen einigermaßen gut umgehen kann, durch Abstrahieren, Analysieren, Distanzieren, verbleiben die Zwickmühlen bei den Kindern unverarbeitet, denn: Ich glaube nicht, dass trotz aller Erklärung der Erwachsenen auf emotionaler Ebene eine Klärung und Erleichterung „im Herzen der Kinder“ stattfindet.
Was also tun? Wenn man schon nicht will, dass sich die Kleinen umarmen – wofür es ja Gründe geben mag –, so müssen wir uns doch viel mehr Gedanken machen, wie wir solche Erlebnisse „zur Sprache“ bringen können. Vielleicht ist (explizite) Sprache auch der falsche Modus, vielleicht ist es eher das Rollenspiel, das den Kindern ein Ventil geben könnte, denn hier geht es um das große Feld des impliziten (Körper-)Wissens. Mir scheint, hier müssen wir hinschauen, gemeinsam, ohne viele Worte.
Döner und Dönerinnen
Es ist nun fast zehn Jahre her, als ich mich zum ersten und bisher einzigen Mal zum Thema Gendersprache unter dem Motto „Sprachgewalt“ geäußert habe. Das Credo von damals: Gendern zerstört die Ästhetik der Sprache und es bleibt dort ohne Wirkung, wo eine Bundeskanzlerin, eine Kampfpilotin oder eine Unternehmerin zur Normalität gehören.
Auch 2021 erscheint mir diese Position nicht falsch zu sein, aber wie immer ist das Ganze vielschichtig und verzwickt, weshalb es einer Aktualisierung bedarf.
- Erstens sind da die pragmatischen Argumente, die auch Gabi in Rückgriff auf den aktuellen ZEIT-Standard aufgegriffen hat: Neben gleichgewichtiger Repräsentanz von Frauen und Männern in den Texten geht es ebenfalls und gleichgewichtig um Lesbarkeit, Schönheit, Tradition und Effizienz. Als Folge dieser Anerkennung von gleichrangigen Werten fliegen alle Sternchen, Unterstriche, Binnen-I etc. als Lösungsoption raus. Favorisiert wird ein Wechsel der weiblichen und männlichen Form als Basismodus und Doppelnennung dann, wenn es zur inhaltlichen Präzisierung beiträgt.
- Zweitens hat Rieke Hümpel in einem sehr lesenswerten Beitrag u.a. auf ein strategisches Argument hingewiesen, das weniger nach der Schönheit fragt, sondern darauf verweist, dass Gendern der Emanzipation (also dem Ausgangsinteresse) selbst schade! Wie das? Durch Gendern werde die Frau permanent in ihrer Geschlechterrolle angesprochen, was so klingen kann, als seien Frauen Opfer und bedürfen des besonderen Beistands.
- Drittens lassen sich anti-libertäre Argumente ausmachen, die über das pragmatische und strategische Argument hinausgehen: Wer nicht ordentlich gendert, ist „anders“, und wer anders ist, wird ausgegrenzt. Darauf hatte auch schon Hümpel verwiesen; Schnell und pauschal läuft man auch bei gut begründeter Kritik Gefahr, als Frauenfeind, Querdenker oder gar Nazi beschimpft zu werden, … also schweigt man lieber und jeder weiß: Mit dem Schweigen beginnt der schleichende Tod unserer Demokratie – großes Besteck also.
Neulich sah ich Ursula von der Leyen in einem Statement im Nachgang zum Sofagate-Fall: „Weil ich eine Frau bin!“ Sie sah in ihrem Frausein den Hauptgrund, warum sie auf dem Sofa und abseits Platz nehmen musste. Zwar lassen sich auch andere Gründe finden, aber von der Leyens lenkte den Blick geschickt vom persönlichen Einzelfall in Richtung all jener Frauen, die solche Verletzungen im Stillen, ohne Kamera, ohne Beobachter erleiden und aushalten müssen.
Wir alle – Frauen wie Männer – sollten aufpassen, dass wir den Frauen wie Männern auf den faktischen Spielfeldern des Lebens nicht die Stühle wegziehen (Achtung Metapher) und stattdessen den kollektiven Blick auf die kleinen Sternchen lenken, so wie Zauberer das allzu gerne tun, um das Wesentliche zu vertuschen. Umgekehrt glaube ich nicht, dass die kleinen Sternchen auch nur einen einzigen Stuhl an die richtige Stelle rücken; oft bleibt das eine akademische Turnübung. Schiefe Machtstrukturen lassen sich durch wechselseitiges Vertrauen Schritt für Schritt aushebeln und da hilft nur eins: anfangen, TUN, z.B. beim Thema Einstellungen (trotz Kinder). Unsere Sprache wird nach diesen Taten natürlich (ohne Zwangsverordnung) folgen.
Querdenken
Wenn man noch vor einiger Zeit in etwa sagen wollte, dass jemand „um die Ecke oder gegen den Strich denken“ kann, wenn man zum Ausdruck bringen wollte, dass dieser jemand sich nicht vom Mainstream leiten lässt, sondern „out of the box“, also jenseits der Grenzen mental agiert, die alle anderen für akzeptiert und normal halten, dann sagte man, dieser jemand sei ein Querdenker. Für solche Menschen – selbstredend Frauen wie Männer – gibt es im Englischen den Ausdruck „Wild Duck“ (vgl. auch hier), was nochmal darauf verweist, dass diese geistig „Wilden“ Widersprüche herausfordern, was den Umgang mit ihnen nicht immer leicht macht.
In den Nullerjahren habe ich mich länger mit dem Thema „Querdenken“ beschäftigt: Zum einen hatte ich damals zusammen mit Hermann Rüppell einen Aufsatz über geistige Besonderheiten von erfinderischen Menschen geschrieben (DANTE), zum anderen ging es in meiner Dissertation um das Thema analoge Kommunikation, also den Gebrauch von passenden Vergleichen und analogen Sprachbildern für die Wissensarbeit zwischen den Disziplinen. Kurz: In meiner Zeit war der Begriff Querdenker für Menschen reserviert, die eine besondere Form von Kreativität besaßen und damit komplexe Probleme lösten, die am Ende alle weiterbrachten.
Heute ist das anders.
Der Begriff wurde über Nacht geklaut, verdreht und für Menschen reserviert, die das Corona-Virus leugnen, Verschwörungstheorien in die Welt setzen und Rechte Gewalt gutheißen. Aus der Warte der Kommunikationsstrategie muss man sagen: Das ist schlau gemacht, denn mit dem Begriff Querdenker grenzen sich solche Gruppen positiv gegenüber dem „vernebelten“ Mainstream ab, also all jenen, die noch nicht die „wirkliche Wahrheit hinter dem Vorhang“ erkennen können.
Nun darf man in diesem freien Land solche Begriffspiraterie betreiben. Was mich ärgert ist, dass die Medien Land auf Land ab diese Bezeichnung übernehmen und pflegen und dabei offenbar nicht merken, dass das den – ja wie nennen wir sie denn nur – in die Hände spielt. Heute darf jeder und jede, die rechts und esoterisch denkt und handelt, sagen, ich bin stolz ein Querdenker zu sein.
Oh Mann, wie weit sind wir damit weg von Querdenkern wie Leonardo da Vinci oder anderen Menschen, die quer durch alle Wissensgebiete Erfindungen gemacht und neue Gedanken zusammengetragen haben, wie weit weg von dem guten Grundgedanken des Querdenker-Clubs mit fast 400.000 Mitgliedern, in dem das laterale Denken gepflegt und Ideen für das Innovationsmanagement in Organisationen ausgetauscht wurden. Ob wir den Begriff nochmal drehen können? Ich glaube nicht, denn ab jetzt hängt am Begriff „die dunkle Seite“, den Geruch bekommt man nicht mehr weg. Also lassen wir ihn fallen und denken uns was Neues aus, dass dürfte ja den „Wild Ducks“ nicht so schwerfallen.
„Didaktik und Methodik“ … da stimmt was nicht!
Für mich war es lange selbstverständlich, alle Fragen rund um den Unterricht pauschal mit „Didaktik und Methodik“ zu klassifizieren. So hatte ich es im Sport- und Pädagogikstudium in den 1990ern gelernt. Und ja, man kann es in vielen Artikeln auch heute noch lesen und man hört es in vielen Workshops von Praktikern genauso wie von wissenschaftlichen Fachleuten. Doch, ist das noch zeitgemäß?
Sucht man nach der Ursache dieser Formulierung, so wird man bei Wolfgang Klafki fündig. Im Funkkolleg 1970 sagt er: „Wir halten es für möglich und zweckmäßig, die Ziel- und Inhaltsfragen von den Methoden- und Medienfragen theoretisch zeitweilig abzuheben“. Klafki, DER Kopf der bildungstheoretischen Didaktik, Theoretiker und Praktiker in einer Person, ging es zwar um eine Verschränkung von materialer (= Inhalte und Ziele) und formaler (= Verhalten) Bildung, was er als kategoriale Bildung bezeichnet, aber „unterm Strich“ war für ihn die Inhaltsfrage immer wichtiger, weswegen er auch von einem Primat der Didaktik sprach, von einer „Didaktik im engeren Sinne“, die einen Vorrang zur Methodik haben sollte. Was von dieser hier nur sehr verkürzt wiedergegebenen Diskussion im Bildungsalltag vieler Praktiker übrig blieb, war eben „Didaktik und Methodik“. Doch ist das gut so? Ich denke nicht: Zum einen, weil es historisch nicht ganz korrekt ist, zum anderen, weil es begriffslogisch wie unterrichtspraktisch eher Verwirrung stiftet.
Schaut man sich modere Definitionen zur Didaktik an, dann wird zwar nicht einhellig, aber doch recht konsensfähig von einer „Wissenschaft vom Lehren und Lernen“ (z.B. Kron) gesprochen. Dort, wo man also das Lehren mit dem Lernen systematisch „koppeln“ will, spricht man von Didaktik. Und unter diesem Dachbegriff ist es dann selbstverständlich, dass wir Inhalts- und Zielfragen ebenso besprechen müssen wie Methoden- und Medienfragen, mindestens!
Beschäftigt man sich heutzutage mit der Gestaltung von formalen „Lernwelten“ (Unterricht, Training, Vorlesung etc.), dann ist man gut beraten, sich am „Didaktischen Design“ zu orientieren. Zum einen sind da alle didaktischen Basisaktivitäten (Inhaltsauswahl und -gestaltung, Aktvierung durch Aufgaben sowie Begleitung durch Feedback, vgl. auch constructive alignment) subsummiert und aufeinander bezogen, zum anderen werden materiale und formale Fragen unter einer pragmatischen Perspektive integriert (keine Denkschulen, wie Berliner, Hamburger etc.), was für den Lehralltag einfach hilfreich ist.
Fazit: Vielleicht sprechen wir in Zukunft lieber einfach von „Didaktik“ als Dachbegriff für alles, was es da zu besprechen gibt, denn „Didaktik und Methodik“ klingt begriffslogisch nach „Tiere und Affen“: Da stimmt was nicht.
„Social Video“ und die Kindsköpfe
Es waren die Anfänge bei Ghostthinker, als wir das Thema Social Video in viele Richtungen ausprobierten und explorierten: Ein Weg führte uns zu den Kindern, in die Grundschule. Den Anstoß dazu gaben damals Richard Heinen und Uwe Rotter (beide damals bei „Lehrer Online“, Richard jetzt bei der Montags Stiftung Jugend und Gesellschaft und Uwe beim Haus der kleinen Forscher), die offenbar noch so viel Kind in sich hatten, dass sie nicht nur die Idee von TechPi & MaliBu gut fanden, sondern auch das nötige Kleingeld für die ersten Serien besorgten – den „Kindsköpfen“ sei Dank!
TechPi & MaliBu? Für alle, die die beiden noch nicht kennen: TechPi ist ein Außerirdischer vom Planeten Omitron mit kreativer Vorliebe für alles Technische; MaliBu ist sein irdischer Freud – ein Schmetterling – der die Sachen gerne mal zu Ende denkt – „tech meets social“ sozusagen. Zusammen erleben die beiden eine Reihe von Geschichten, die nicht nur für sie lehrreich sind, sondern immer wieder Kinder in den Bann ziehen: Klimaschutz, Umweltprobleme, Natur- und Artenschutz etc. und die Rolle des Menschen, also all das, was uns auch heute beschäftigt und was sich mit dem Begriff der „Dilemmata“ – sowas wie Zwickmühlen – auf den Punkt bringen lässt.
Unser Ziel war damals, über kurzweilige Kindergeschichten, diese Dilemmata zu skizzieren, um bei Kindern im Grundschulalter ein Interesse für diese Art von Problemen und zu wecken. Es ging um eine Denkhaltung, nicht mehr, aber auch nicht weniger!
Neben den aufwändigen Video-Geschichten (Inhalte) haben wir schon damals an mehr Beteiligung und Interaktion gedacht: Kinder konnten diese Videos im Klassenverbund mit Hilfe von Aufgabenblättern kommentieren, per Text und per Audio, was sie zum Weitererzählen der Geschichten animierte, also Social Video der besonderen Art. Wie toll das funktionierte, zeigte die Masterarbeit von Monika Gröller, die in einer Fallstudie herausfand, dass sich die Grundschulkinder tief in die Problemstellung eingraben und auch noch Wochen später, motiviert und informiert von den Geschichten und ersten „Lösungsversuchen“, berichten konnten (vgl. hier)
Aus aktuellem Anlass hat der Verein „Lebensraum Lechtal“ um Bereitstellung der Folge „Sackgasse am Fluss“ gebeten (der Verein war Sponsor!). Wir haben das nun in Absprache mit dem Verein auch auf YouTube gestellt.
Zwei Sachen sind mir wichtig:
- Man sieht was herauskommt, wenn „Kindsköpfe“ ihre Köpfe und Ressourcen zusammenbringen; zu den Kindsköpfen zählen mindestens auch Gabi Reinmann (mit der ich die Figuren entwickelt und Geschichten geschrieben habe), Johannes Metscher (technische Leitung des Projekts), Marco Rosenberg (Stimmen) und Frank Cmuchal – letzterer ist für die tollen Zeichnungen verantwortlich.
- Die Figuren sind aus meiner Sicht zeitlos „schön“ und der didaktische Rahmen (tech meets social) scheint mir heute mehr als zeitgemäß! Vielleicht findet sich ja ein Verlag, der das Ganze in einem professionellen Rahmen fortführen will. Der Anfang ist gemacht!